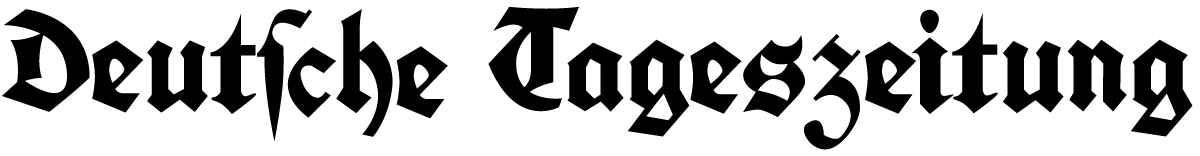OECD hebt globalen Wirtschaftsausblick für 2023 leicht auf 2,7 Prozent an

Die OECD hat ihren Wirtschaftsausblick für die globale Konjunktur in diesem Jahr leicht angehoben - für Deutschland erwartet die Organisation allerdings eine Stagnation. Angesichts der Öffnung der chinesischen Wirtschaft und sinkender Energiepreise geht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von einem globalen Wachstum von 2,7 Prozent aus - bei der vorherigen Schätzung im März hatte sie noch 2,6 Prozent prognostiziert. Für 2024 erwartet sie unverändert 2,9 Prozent.
Den Ausblick erhöhte die OECD nun unter anderem für die USA mit einem erwarteten Wachstum von 1,6 Prozent, für China mit 5,4 Prozent und für die Eurozone mit 0,9 Prozent. In Russland geht die Organisation in diesem Jahr von einem Rückgang der Wirtschaft um 1,5 Prozent aus.
Jedoch sei der erwartete Konjunkturaufschwung "noch unstabil und die Abwärtsrisiken überwiegen", mahnte die OECD. Sie nannte vor allem die unklare Entwicklung im Ukraine-Krieg, außerdem seien positive Faktoren wie das zuletzt milde Winterwetter in Europa "nächstes Jahr möglicherweise nicht mehr gegeben". Die weiterhin hohe Kerninflation bleibe ein weiteres Risiko.
Für die Bundesrepublik geht die OECD in diesem Jahr von einem Stillstand der Wirtschaft aus - erst nächstes Jahr könnte die Konjunktur demnach wieder um 1,3 Prozent zulegen. Haupthemmnis für die deutsche Konjunktur ist laut OECD die hohe Inflation, durch die der private Konsum gedämpft werde.
Unter den OECD-Mitgliedern geht die Organisation insgesamt von einer Inflation von 6,6 Prozent in diesem Jahr und 4,3 Prozent im kommenden Jahr aus, nach hohen 9,4 Prozent im vergangenen Jahr. Der erwartete Rückgang sei "der Wirkung der gestrafften Geldpolitik, sinkenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen und geringeren Lieferengpässen zu verdanken", teilte die OECD mit.
Sie mahnte, die Geldpolitik müsse "restriktiv bleiben, bis es klare Anzeichen dafür gibt, dass der Inflationstrend dauerhaft gesenkt wurde". Außerdem empfahl sie, fiskalische Maßnahmen, die zur Unterstützung während der Pandemie und des Krieges nötig waren, zurückzufahren, zielgenauer auszugestalten und stärker auf künftige Anforderungen auszurichten.
(L.Møller--DTZ)