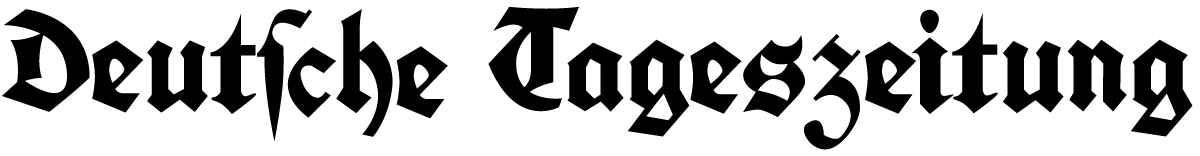Islamistische Propaganda bleibt in sozialen Netzwerken weit verbreitet

Islamistische Propaganda bleibt in den sozialen Netzwerken weit verbreitet. Zu diesem Schluss kommt der Lagebericht Islamismus im Netz 2018, der am Dienstag in Berlin von dem Bund-Länder-Kompetenzzentrum jugendschutz.net vorgestellt wurde. Fortschritte gibt es demnach allerdings bei der Löschung strafbarer Inhalte.
Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr 649 Angebote mit zusammen 872 Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen registriert, davon 85 Prozent auf den führenden Netzwerken Youtube, Instagram, Telegram und Facebook.
Dabei sei es in 491 Fällen um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegangen, in 174 Fällen um Kriegsverherrlichung, in 172 Fällen um Gewaltdarstellungen und Verletzungen der Menschenwürde und in 35 Fällen um sonstige Gesetzesverstöße.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang. 2017 waren demnach noch 786 Angebote mit 1547 Gesetzesverstößen registriert worden. Eine Ursache dafür sei der starke Rückgang von IS-Propaganda nach dem Tod oder der Festnahme vieler Akteure und dem Verlust des zeitweise von der Dschihadistenorganisation kontrollierten Territoriums.
Die meisten der Verstöße (85 Prozent) entdeckte demnach jugendschutz.net selbst im Rahmen seines Monitoring. Auf die übrigen Fälle wurde das Kompetenzzentrum durch Hinweise von Partnerorganisationen, Jugendschutzeinrichtungen oder Beschwerden von Internetnutzern aufmerksam.
In 82 Prozent der 2018 entdeckten Fälle sei eine Löschung oder Sperrung erreicht worden. Ausschlaggebend war dabei der Studie zufolge fast ausschließlich - in 98 Prozent der Vorgänge - ein direkter Kontakt zum jeweiligen Provider.
Hohe Lösch- oder Sperrquoten erreichten vor allem Youtube (99 Prozent der beanstandeten Inhalte) und Instagram (98 Prozent), gefolgt von Facebook (82 Prozent). Deutlich geringer war die Erfolgsquote bei dem ursprünglich besonders in Russland verbreiteten Dienst Telegram (58 Prozent). Sonstige Plattformen kamen auf durchschnittlich 88 Prozent.
Generell knüpfe islamistische Propaganda häufig direkt an Sehgewohnheiten Jugendlicher an und versuche, diese in ihrer Lebenswelt abzuholen. Auf diese Weise sollten auch Nutzer erreicht werden, die zuvor keine Berührung mit extremistischen Gruppierungen hatten. Gezielt würden etwa aktuelle Debatten oder aktuelle Filme und Computerspiele aufgegriffen. Verschwörungstheorien würden genutzt, um Misstrauen gegen den Rechtsstaat zu schüren.
Auch bemühten sich die Autoren, an Diskriminierungserfahrungen muslimischer Jugendlicher "anzudocken". Ein Beispiel war demnach die Debatte um das Ausscheiden des türkischstämmigen Fußballers Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Appelle an das Gerechtigkeitsgefühl habe es auch im Rahmen der Twitter-Kampagne "#NichtOhneMeinKopftuch" gegeben, in der Gerüchte über ein in Deutschland drohendes Kopftuchverbot gestreut worden seien.
Zu einem der wichtigsten Verbreitungswege für islamistische Propaganda hat sich laut jugendschutz.net in den vergangenen Jahren der Dienst Telegram mit Sitz in Dubai entwickelt. Über Telegram seien 2018 auch konkrete Anleitungen für den "heimischen Kampf" verbreitet worden, beispielsweise zum Bau von Bomben oder zum Verüben von Anschlägen. Es gab dort demnach aber auch vermehrt subtilere Propaganda, etwa zugunsten einer "Gefangenenhilfe".
"Islamistische Akteure kommunizieren bewusst wie Jugendliche und bieten sich als Vertraute an, die die Sorgen, Ängste und Fragen junger Menschen verstehen und ihnen Orientierung geben wollen", schrieb im Vorwort des Berichts Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Mit "lebensnahen Angeboten" versuchten diese, "Kinder und Jugendliche zu ködern" und "zum Mitmachen oder zur Weiterverbreitung islamistischer Inhalte" anzuregen.
(V.Korablyov--DTZ)