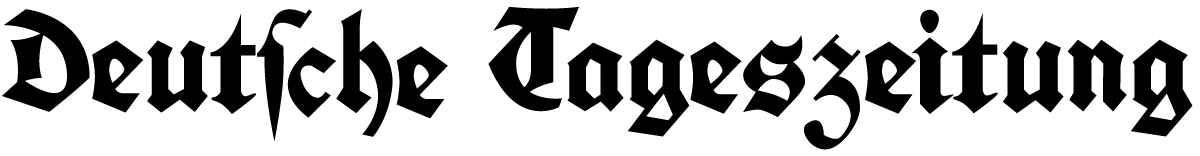Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner darf Haftstrafe im Hausarrest absitzen

Die frühere argentinische Präsidentin Cristina Kirchner darf ihre sechsjährige Haftstrafe wegen Korruption im Hausarrest absitzen. Ein Gericht entschied am Dienstag, dass die 72-jährige Linkspolitikerin nicht ins Gefängnis muss. Die Ex-Präsidentin (2007 bis 2015) muss sich während des Hausarrestes, der am Dienstag begann, aber elektronisch überwachen lassen.
Kirchner, auf die 2022 ein Attentat verübt worden war, hatte für ihren Antrag auf Hausarrest unter anderem Sicherheitsgründe angeführt. Als Ex-Präsidentin habe sie lebenslang Anrecht auf Polizeischutz, dies sei im Gefängnis aber nicht möglich.
Die Staatsanwaltschaft wollte derweil verhindern, dass die politische Gegnerin des ultrarechten Präsidenten Javier Milei ihre Haftstrafe im Hausarrest und nicht im Gefängnis absitzt. Die Behörde erklärte, es gebe weder gesundheitliche noch persönliche Gründe für eine Haftverschonung.
Das Gericht gewährte Kirchner schließlich Hausarrest unter elektronischer Bewachung. Das argentinische Recht sieht vor, dass Verurteilte über 70 Jahren Haftstrafen im Hausarrest absitzen können.
Das Oberste Gericht in Argentinien hatte vergangene Woche die Verurteilung der Linkspolitikerin bestätigt. Kirchner war im Dezember 2022 der Korruption zum Schaden des Staates schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Zudem entschied das zuständige Gericht, dass sie bis an ihr Lebensende keine politischen Ämter innehaben dürfe.
In dem Prozess ging es um öffentliche Ausschreibungen in der Provinz Santa Cruz im Süden des Landes unter anderem während Kirchners Präsidentschaft. Die Politikerin, deren 2010 verstorbener Ehemann Néstor Kirchner das südamerikanische Land zwischen 2003 und 2007 als Präsident führte, hatte den Prozess von Beginn an als "politisch motiviert" kritisiert.
(L.Svenson--DTZ)