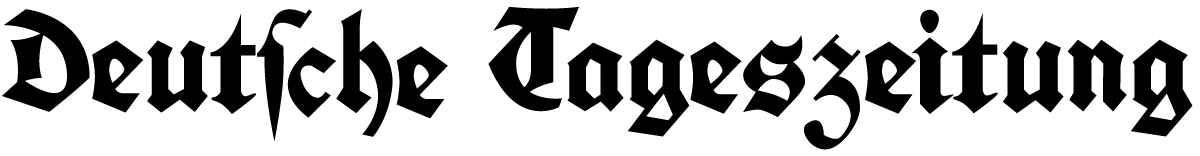Rettungsschiffe aus Deutschland und Spanien auf der Suche nach sicherem Hafen

Nach ihrer Abweisung durch Italien sind zwei Hilfsschiffe aus Deutschland und Spanien auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye und das spanische Schiff "Open Arms" haben insgesamt 164 Flüchtlinge an Bord. Angesichts des Streits innerhalb der EU über die Aufnahme von in Mittelmeer geretteten Migranten warb die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen "neuen Pakt" in der Einwanderungspolitik.
Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms teilte am Freitag mit, ihr Schiff "Open Arms" habe in der Nacht vor der Küste Libyens 69 Bootsflüchtlinge gerettet. Sie müssten sich den Platz an Bord mit den 55 Flüchtlingen teilen, die bereits am Donnerstag gerettet worden waren.
Die Fahrt in einen italienischen Hafen blieb der "Open Arms" verwehrt: Italiens Innenminister Matteo Salvini hat angeordnet, das Rettungsschiff nicht in italienische Gewässer einfahren zu lassen. Die "Open Arms" fuhr daher ohne klares Ziel nordwärts.
Am Donnerstag hatte Salvini bereits dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" die Einfahrt in einen italienischen Hafen verwehrt, die mit 40 geretteten Flüchtlingen auf dem Weg zur Insel Lampedusa war. Am Freitag nahm die "Alan Kurdi" Kurs auf Malta.
Proactiva Open Arms hob hervor, dass die 69 in der Nacht zu Freitag geretteten Flüchtlinge "schreckliche Spuren der Gewalt" trügen. Zu ihnen zählten zwei Kinder und eine im neunten Monat schwangere Frau mit Wehen. Zu den 55 zuvor geretteten Flüchtlingen gehören den Angaben zufolge zwei Babys und etwa 15 Frauen.
Seit Sommer vergangenen Jahres waren alle von Proactiva Open Arms geretteten Migranten in Spanien von Bord gegangen. Nach Angaben der Hilfsorganisation haben die spanischen Behörden ihr aber mittlerweile unter Androhung einer Geldstrafe zwischen 200.000 und 900.000 Euro untersagt, zu Einsätzen vor die Küste Libyens zurückzukehren.
Zu den 40 Geretteten auf der "Alan Kurdi" gehören laut Sea-Eye drei Kinder, eine Schwangere sowie ein Mann mit Schusswunden. Die italienischen Behörden hätten aber auf die Zuständigkeit des hundert Seemeilen entfernten Nachbarlandes Malta verwiesen. Das Hilfsschiff sei nun dorthin unterwegs.
Derweil kündigten zwei Hilfsorganisationen neue Rettungseinsätze im Mittelmeer an. Die im Mai von der italienischen Justiz beschlagnahmte "Mare Jonio" werde in Kürze wieder auslaufen, teilte die italienische NGO Mediterranea mit. Auch das Rettungsschiff "Ocean Viking" der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen wird für seinen nächsten Einsatz vorbereitet.
Aus dem Bundesinnenministerium in Berlin hieß es am Freitag, der Bundesregierung sei es "ein Anliegen, Menschen vor dem Ertrinken zu retten und zu vermeiden, dass Schiffe tage- oder wochenlang vor den europäischen Häfen liegen, bevor sie anlegen dürfen". Sie habe sich daher "im laufenden Jahr in allen bisherigen Fällen freiwillig zur Übernahme der Zuständigkeit für aus Seenot gerettete Personen aus dem Mittelmeer bereit erklärt".
Die EU-Länder streiten seit langem über die Verteilung von Flüchtlingen. Italien fordert, die sogenannten Dublin-Regeln zum Umgang mit Asylbewerbern zu ändern. Sie sehen vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten.
Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb am Freitag bei einem Besuch in Rom für einen "neuen Pakt" in der EU-Einwanderungspolitik. "Wir müssen die Dublin-Regeln anpassen, um die Migrationsströme effizienter zu bewältigen", sagte von der Leyen nach Gesprächen mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte. Derzeit seien die Mittelmeerländer Italien, Spanien und Griechenland besonders stark belastet. Die anderen EU-Länder müssten nun mehr Solidarität beweisen.
(V.Sørensen--DTZ)