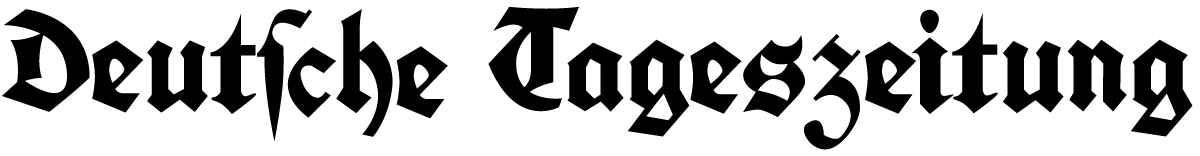Unicef: Corona-Pandemie bewirkt deutliche Ausweitung der Kinderarbeit

Wegen der Corona-Pandemie fürchten die Vereinten Nationen eine weltweite Ausweitung der Kinderarbeit. Millionen weitere Minderjährige könnten als Folge der Gesundheitskrise in Arbeit gedrängt werden, erklärten das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in einem am Freitag zum Welttag gegen Kinderarbeit veröffentlichten Bericht. Die Fortschritte der vergangenen Jahre seien "heute in Gefahr". Die Bundesregierung kündigte an, den Kampf gegen Kinderarbeit zu einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu machen.
"Da die Pandemie verheerende Auswirkungen auf das Familieneinkommen hat, könnten viele auf Kinderarbeit zurückgreifen", erklärte ILO-Chef Guy Ryder. Nach Angaben der Weltbank könnte die Zahl der Menschen in extremer Armut allein in diesem Jahr um bis zu 60 Millionen steigen - und deshalb auch die Kinderarbeit zunehmen, wie es in dem Bericht heißt. Die Corona-Krise berge "sehr reale Risiken eines Rückschritts". Dem Report zufolge sank die Zahl der weltweit arbeitenden Kinder seit dem Jahr 2000 um 94 Millionen.
Kinder, die in der Corona-Krise Elternteile verloren hätten, drohe das Schicksal, als Ernährer für die Familie einspringen zu müssen, warnten die beiden UN-Unterorganisationen. Besonders Mädchen seien von Ausbeutung betroffen und würden in der Landwirtschaft oder im Haushalt eingesetzt werden.
Bereits die wegen der Pandemie verhängten Schulschließungen, die mehr als eine Milliarde Schüler weltweit betreffen, haben nach Angaben der Organisationen nachweislich zu mehr Kinderarbeit geführt. Unicef und ILO fürchten allerdings, dass die Zahl weiter ansteigt, auch wenn Schulen wieder öffnen. Eltern könnten zum Beispiel nicht mehr in der Lage sein, die Schulgebühren für ihre Kinder zu zahlen.
In der gemeinsamen Studie der beiden UN-Unterorganisationen wird auch davor gewarnt, dass infolge der Corona-Krise bereits arbeitende Minderjährige noch länger und unter noch schlechteren Bedingungen arbeiten müssten.
Die Organisationen forderten zum Schutz der Kinder die Abschaffung der Schulgebühren und den erleichterten Zugang armer Haushalte zu Krediten. "Wenn wir uns die Welt nach Covid-19 neu vorstellen, müssen wir sicherstellen, dass Kinder und ihre Familien die Mittel haben, die sie brauchen, um ähnliche Stürme in der Zukunft zu überstehen", sagte die Unicef-Chefin Henrietta Fore.
Nach den jüngsten ILO-Schätzungen von 2017 wurden im Zeitraum von 2012 bis 2016 rund 152 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen, darunter 73 Millionen unter gefährlichen Bedingungen.
Die Bundesregierung kündigte derweil an, den Kampf gegen Kinderarbeit zu einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu machen. Im kommenden halben Jahr sollten die Grundlagen für ein europäisches Lieferkettengesetz geschaffen werden, das der Eindämmung der Ausbeutung von Kindern diene, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Gesetz solle auch für faire Löhne für Eltern in armen Ländern sorgen.
Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Das Lieferkettengesetz, über das die Bundesregierung mit den EU-Partnern in diesem Zeitraum beraten will, soll große Unternehmen zur Wahrung von Menschenrechten bei ihren Produzenten und Zulieferern verpflichten.
Die für das Thema Kinderarbeit zuständige SPD-Politikerin Josephine Ortleb forderte die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf und drängte ihrerseits auf das Lieferkettengesetz. Deutschland könnte damit Lieferketten "von Beginn an kontrollieren und für faire, sichere und gute Arbeitsbedingungen und Bezahlung sorgen", erklärte Ortleb.
(S.A.Dudajev--DTZ)