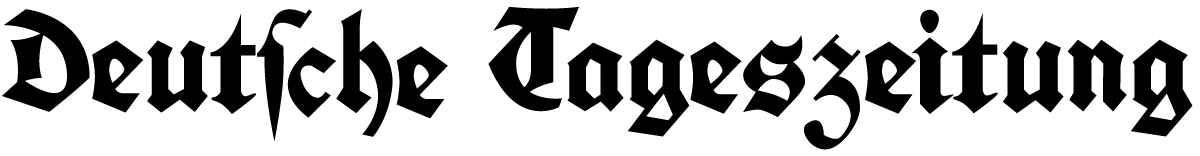Sicherheitsbehörden verlangen nach Angriff von Halle mehr Befugnisse

Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle fordern Sicherheitsbehörden und Union schärfere Sicherheitsgesetze, ernten dafür aber auch Widerspruch. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang verlangte für seine Behörde das Recht auf Online-Durchsuchungen und die Überwachung verschlüsselter Kommunikation. Die Polizei machte derweil Angaben zum aktuellen Gefährderpotenzial: Sie geht derzeit von mindestens 43 rechten Gefährdern bundesweit aus.
"Wir müssen dem Rechtsextremismus entschieden und konsequent nachrichtendienstlich begegnen", erklärte Haldenwang in Berlin. Zudem setzt sich das Bundesamt für die Erhöhung der Speicherfristen im Nachrichtendienstlichen Informationssystem (Nadis) von zehn auf 15 Jahre ein.
Das BKA befürwortet die Pläne von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die Betreiber sozialer Netzwerke zur Meldung strafbarer Inhalte zu verpflichten.
Zudem tritt das BKA dafür ein, dass "Outing" unter Strafe zu stellen. Damit soll gegen die gängige Praxis von Rechten vorgegangen werden, Namen politischer Gegner auf so genannten Todeslisten zu veröffentlichen. Zudem solle die bislang auf zwölf Monate begrenzte Speicherfrist für Daten, die keinem Verfahren zugeordnet werden können, verlängert werden.
"Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass rechte Gewalt- und Propagandadelikte zunehmen", sagte BKA-Präsident Holger Münch. Die Zahl der gewaltbereiten Rechten liegt dem Verfassungsschutz zufolge bei 12.700. Deshalb könnte die tatsächliche Zahl der Gefährder bereits jetzt höher liegen als die von den Ländern genannten 43.
Der CDU-Politiker Patrick Sensburg wies die Furcht vor zu weitgehenden Eingriffen in die Privatsphäre durch neue Behördenbefugnisse zurück. "Wir brechen die Verschlüsselung natürlich nicht bei jedem, sondern bei einem konkreten Anlass - bei den Personen, die zum Beispiel im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen", sagte er dem Deutschlandfunk.
Wenn der Verfassungsschutz Zugriff auf verschlüsselte Internetkommunikation bekomme solle, müsse er dafür die Zustimmung der so genannten G10-Kommission des Bundestags einholen, sagte Sensburg. Dieses erteilt Genehmigungen für Ermittlungen, die in das Fernmeldegeheimnis eingreifen.
Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, wandte sich gegen schärferen Sicherheitsgesetzen gewarnt. "Bevor der Staat neue Überwachungsmaßnahmen einführt, müssen die bestehenden Regelungen in einer Gesamtschau bewertet werden", schrieb Kuhle in einem Gastbeitrag für das Düsseldorfer "Handelsblatt". Dann könnten Bürger, Parlament und Sicherheitsbehörden sehen, "inwiefern das Gesamtmaß an Überwachung das für eine Demokratie erträgliche Maß überschreitet".
Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte bemängelte, bei der Bekämpfung von rechtem Terror fehlten nicht die Instrumente, sondern das Problembewusstsein bei Ministerien und Polizei: "Wer nicht in die richtige Richtung guckt, dem nützt das beste Fernglas nichts."
Wenn das BKA 43 rechte Gefährder zähle, sei dies "ein schlechter Witz, fügte Korte hinzu. Es zeige, "dass man dort nichts dazugelernt hat". 2018 seien knapp 500 Rechtsextremisten per Haftbefehl gesucht worden, jeder fünfte davon gewalttätig.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach sich dafür aus, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz rasch auf den Prüfstand zu stellen. Das gelte für alles, was heute noch gewährleistet, dass die Täter sich im Netz verbinden könnten und es zu solchen Taten komme. Für bedrohte Menschen sollten Anlaufstellen geschaffen werden. "Wir dürfen sie als Gesellschaft nicht alleine lassen", erklärte Göring-Eckardt.
(W.Novokshonov--DTZ)