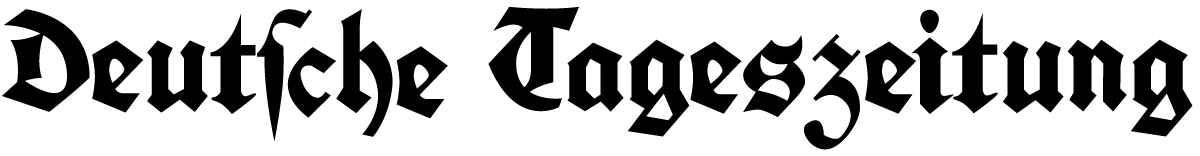Bericht: Pendler können vom Klimapaket profitieren

Vom Klimapaket der Bundesregierung profitieren einem Medienbericht zufolge viele Pendler, auch wenn sie Auto fahren. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, würde die höhere Pendlerpauschale für viele Autofahrer die Mehrkosten aus den neuen CO2-Preisen ausgleichen. Dabei berief sich die Zeitung auf eigene Berechnungen und Auswertungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
Die Pläne der großen Koalition sehen einerseits eine CO2-Bepreisung im Verkehrssektor vor, zugleich aber auch eine Anhebung der Pendlerpauschale ab dem Jahr 2021 bei Strecken von mehr als 20 Kilometern. Die Pauschale soll dann auf 35 Cent steigen - fünf Cent mehr als derzeit pro Kilometer von der Steuer abgesetzt werden können.
Hintergrund hierbei ist nach Angaben von Union und SPD, dass Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurücklegen müssen, oft weder auf ein ausgebautes ÖPNV-Angebot zurückgreifen noch eine ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos nutzen können. Dies werde sich in den kommenden Jahren aber ändern. Deshalb ist im Klimapaket vorgesehen, die Erhöhung der Pendlerpauschale bis Ende 2026 zu befristen.
Wie die "FAS" nun berichtete, würde den Plänen zufolge 2021 beispielsweise ein Polo-Fahrer mit geringem Einkommen insgesamt entlastet, wenn er mehr als 28 Kilometer von der Arbeit weg wohnt. Mit der Zeit schrumpfe die Entlastung aber. Schon im Jahr 2023 überwiegt die Belastung durch den CO2-Preis bis zu einer Entfernung von 77 Kilometern.
Eine Modellrechnung der Zeitung und des DIW-Steuerexperten Stefan Bach zeigt demnach, dass derjenige, der mehr versteuert, auch mehr Steuern sparen kann: Ein Spitzenverdiener zum Beispiel werde im ersten Jahr schon ab einer Entfernung von 25 Kilometern entlastet, selbst wenn er ein großes BMW-X7-SUV fahre.
Gleichzeitig mache die geplante Abwrackprämie für Ölheizungen den Erwerb einer klimafreundlichen Heizung attraktiv. Wer eine alte Ölheizung durch ein neues, effizientes System ersetzt, soll 40 Prozent der Einbaukosten an den Staat abgeben können.
"Durch die Abwrackprämie werden Wärmepumpen gegenüber Ölheizungen günstiger" sagte Johannes Wagner vom Energiewirtschaftlichen Institut in Köln (EWI) der "FAS". Eine neue Ölheizung für ein Einfamilienhaus verursacht laut seiner Modellrechnung künftig Kosten von 42.500 Euro für Einbau und Betrieb während einer Nutzungsdauer von 20 Jahren.
Eine Wärmepumpe schlage nur mit 33.000 Euro zu Buche. Allerdings sei es oft erforderlich, die Hauswand zu dämmen, bevor eine Wärmepumpe eingebaut werden könne. Neue Ölheizungen sollen den Koalitionsplänen zufolge von 2026 an verboten sein.
Auch Flugtickets sollen teurer werden - denn eine höhere Luftverkehrssteuer soll dem Staat das Geld ersetzen, das durch eine Mehrwertsteuer-Senkung auf Bahntickets im Fernverkehr entsteht.
Der "FAS" zufolge müsste die Luftverkehrssteuer dazu um rund 40 Prozent steigen. Das wäre für innereuropäische Flüge eine Erhöhung von 7,38 Euro pro Ticket auf etwas über zehn Euro, für Langstrecken von 41,49 Euro auf knapp 60 Euro, berichtete die Zeitung. Diese Zahlen gelten demnach, falls der Aufschlag alle Steuersätze gleichmäßig trifft.
(A.Nikiforov--DTZ)