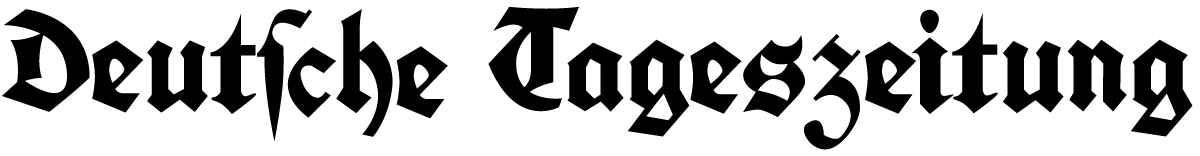Grüne fordern Bund-Länder-Programm für Studentenwohnheime

Die Grünen haben ein Bund-Länder-Programm zur Schaffung von Wohnheimplätzen für Studenten gefordert. "Die Mietenexplosion hat die Studierenden voll erfasst", sagte Kai Gehring, hochschulpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Donnerstag. In Hochschulstädten kosteten kleine Wohnungen mittlerweile im Schnitt mehr als 400 Euro und damit deutlich mehr als die 325 Euro, die im Bafög für das Wohnen gewährt werden.
Verschärfend komme der Mangel an Wohnheimplätzen hinzu, sagte Gehring. Nur noch 9,6 Prozent der Studierenden fänden Platz in Wohnheimen. "Eine gemeinsame Wohnheim-Offensive mit den Ländern ist die richtige Antwort auf lange Wartezeiten auf einen Wohnheimplatz", sagte der Grünen-Abgeordnete. "Andernfalls drohten zu Semesterbeginn weiter Zelt- oder Matratzenlager auf dem Campus."
In ihrem Antrag schlagen die Grünen zudem weitere Maßnahmen gegen die Wohnungsnot von Studenten vor. So sollen ungenutzte und leerstehende Gebäude des Bundes für günstiges studentisches Wohnen genutzt werden. Hochschulstädte sollen zudem innenstadtfernere Quartiere etwa durch ein besseres Nahverkehrsangebot für Studenten attraktiv machen. Außerdem verlangen die Grünen, dass die Mietkostenpauschale im Bafög regional gestaffelt wird.
Es sei auch falsch, dass die Mietpreisbremse nicht für teure, möblierte Wohnungen und Zimmer gelte. "Diese Schlupflöcher müssen weg - auch und gerade in den Universitäts- und Hochschulstädten", forderte Gehring.
Der am Mittwoch veröffentlichte Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hatte gezeigt, dass Studierende in Deutschland immer schwerer eine bezahlbare Wohnung finden. Die Mieten in 30 untersuchten Hochschulstädten erreichten neue Rekorde. Für eine studentische Musterwohnung mit 30 Quadratmetern rund anderthalb Kilometer von der Hochschule entfernt stiegen die Mieten im Vergleich zum vergangenen Jahr im Schnitt um 4,6 Prozent - in einigen Städten allerdings noch deutlich mehr.
(V.Sørensen--DTZ)