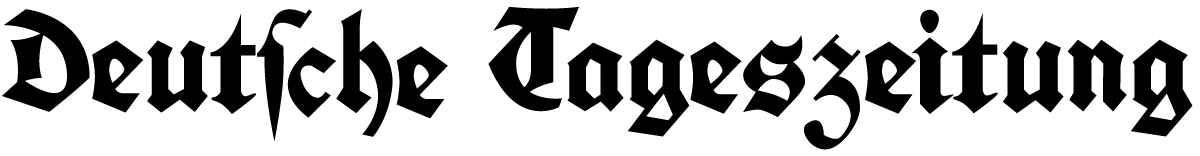Wirtschaftsinstitut DIW sieht Jobwachstum für 2020

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet für das kommende Jahr trotz konjunktureller Risiken ein stabiles Wachstum am Arbeitsmarkt. "Wir rechnen mit 150.000 zusätzlichen neuen Jobs im nächsten Jahr, das ist ganz ordentlich", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher der "Augsburger Allgemeinen" von Dienstag. Die Wirtschaft werde nach 0,5 Prozent im abgelaufenen Jahr im neuen Jahr laut der DIW-Prognose um 1,2 Prozent wachsen und im Jahr 2021 um 1,4 Prozent.
Es gebe durchaus Grund für Optimismus, betonte Fratzscher. "Wir haben eine hoch wettbewerbsfähige Wirtschaft" - "tolle Exportunternehmen", die im globalen Wettbewerb bestehen, und einen "hervorragenden Arbeitsmarkt".
Allerdings gebe es auch viele dunklen Wolken am Konjunkturhimmel, räumte der Ökonom ein. "Die Risiken sind enorm." Viele unterschätzten die Gefahr, dass sich US-Präsident Donald Trump Deutschland und Europa "doch noch vorknöpft", warnte der DIW-Chef. Er befürchte dies für 2020 wegen der Präsidentschaftswahlen in den USA.
Die Politik müsse deshalb gegensteuern, forderte Fratzscher. Dabei gehe die Debatte über eine Unternehmensteuersenkung an den eigentlichen Problemen vorbei. Diese seien die Regulierung und eine "überbordende Bürokratie". Diese Probleme würden durch Steuersenkungen nicht gelöst.
In Deutschland fehle es an Tempo, kritisierte der DIW-Chef: "Die Bürokratie ist hierzulande häufig zu langsam." Zudem fehlten Fachkräfte und langfristige Investitionsprogramme, auf die sich die Kommunen verlassen könnten. Leider gebe es auch eine "schlechte digitale Infrastruktur". Ein Investitionsprogramm, das nur auf zwei Jahre angelegt sei, werde deshalb scheitern.
Fratzscher forderte zur Finanzierung eine Diskussion, wie Vermögen stärker an den Staatsausgaben beteiligt werden könnten. Seine erste Präferenz sei nicht die Vermögenssteuer, die "teuer und schwierig zu erheben" sei. Dies könne zu falschen Anreizen und zu Kapitalflucht führen. "Meine bevorzugte Form wäre, die Grundsteuer auf Boden und Immobilien zu erhöhen. Und eine faire Erbschaftssteuer, die alle im Prinzip gleich behandelt", fügte er hinzu. Kein anderes Industrieland besteuere Arbeit so stark und Vermögen so gering wie Deutschland, betonte er. (P.Vasilyevsky--DTZ)